
Man spricht bairisch

Der Markt Thierhaupten im Landkreis Augsburg gehörte nicht immer zu Schwaben. Doch wie, wann und warum kam es dazu, dass der Ort zum schwäbischen Landkreis kam?
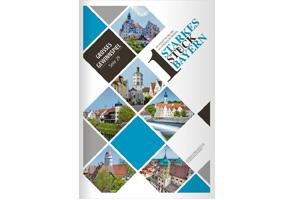
Vergelt’s Gott und pfia Gott“, verabschiedet sich der erste Vorsitzende des Heimat- und Trachtenvereins Thierhaupten, Franz Xaver Rechner, in schönstem bayerischen Dialekt am Ende des Telefonats. An sich nichts Ungewöhnliches – im Großraum Augsburg wird sowohl schwäbisch wie auch bayerisch gesprochen, je nachdem, auf welcher Seite des Lechs eine Gemeinde liegt. Denn der Fluss war schon immer auch eine Sprachgrenze, weil er die Menschen trennte. Jeder blieb auf seiner Lechseite, so erhielten sich die Dialekte.

Aber Franz Xaver Rechner lebt in Hölzlarn, einer Gemeinde, die zu Thierhaupten und damit zum Landkreis Augsburg gehört. Hier wird üblicherweise ganz ordentlich „geschwäbelt“, nicht aber so in Thierhaupten. Wie kam es dazu?
Wer sich die Karte des Landkreis Augsburg genau ansieht, stellt fest, dass dieser überwiegend links – oder besser westlich – des Lechs verläuft. Ganz deutlich sieht man aber auch, dass sich ganz oben eine Ausbuchtung über den Lech ins altbayerische Gebiet befindet. Mittendrin die Gemeinde Thierhaupten, die mit der Lage östlich des Lechs eher zum Landkreis Aichach-Friedberg oder Neuburg gehören müsste.
Volkes Wille
Wie, wann und warum kam es aber dazu, dass der Markt zum schwäbischen Landkreis kam? Man schrieb das Jahr 1972. Im Rahmen der damaligen Gebietsreform (siehe Kasten links) sollten die Thierhauptener in einer Bürgerabstimmung entscheiden, zu welchem Landkreis sie gehören wollten. Bis dahin zählte der Ort zum Landkreis Neuburg an der Donau und damit zum bairischen Dialektgebiet, ebenso wie der Landkreis Aichach-Friedberg. Alle waren oberbayerisch und bildeten gemeinsam mit Niederbayern und der Oberpfalz sowie einigen kleineren angrenzenden Regionen Altbayern.
Trotzdem entschieden sich 90 Prozent in der Abstimmung für den Landkreis Augsburg. Obwohl selbst der damalige Bürgermeister stark nach Neuburg orientiert war und einige Thierhauptener Kreisräte in Neuburg waren. Gründe für die Entscheidung waren jedoch sozioökonomische Verbindungen der Wirtschaft, die Aus- und Weiterbildung sowie die Zuganbindungen. Damit gehörte Thierhaupten ab 1972 zum Landkreis Augsburg-West, der ab 1973 die heutige Bezeichnung Landkreis Augsburg erhielt.
Die neue Zugehörigkeit war anfangs nicht einfach für die Bevölkerung, schließlich sind die kulturellen Bezüge Thierhauptens nach wie vor eher oberbayerisch geprägt. Manche bezeichneten sich deshalb als „Zwangsschwaben“ oder „Mussschwaben“. Doch das ist inzwischen fast 46 Jahre her. Wie spricht, denkt und fühlt man heute in Thierhaupten und den Ortsteilen: schwäbisch, bayerisch oder bayerisch-schwäbisch?
„Also im Freundeskreis wird noch ab und zu über die Landkreisverlegung gewitzelt. Aber die meisten Bürger fühlen sich heute als Schwaben“, sagt dazu Karl Haag, Rechners Vorgänger im Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten. Zwar gäbe es gerade unter den Älteren noch einige, deren Herz an Altbayern hängt und die auch noch die in Thierhaupten übliche, bayerische Tracht tragen, aber im Großen und Ganzen fühle man sich im Landkreis Augsburg gut aufgehoben. Das bestätigt auch Franz Rechner. Sicher, es wird bei den Treffen im Heimatverein, beim Hoagarten (nicht wie im Schwäbischen Hoigarten), beim Engerlmarkt (nicht Engelesmarkt) und gerade unter den älteren Mitbürgern noch überwiegend bayerisch gesprochen, aber schon bei den jüngeren im Verein sei das nicht mehr der Fall.
Bräuche verändern sich
Nach und nach verschwinden auch einige einst bayerische Bräuche wie der Leonhardiritt von Thierhaupten nach Hölzlarn, der früher immer am 6. November abgehalten wurde, andere aber bleiben, wie das Jaudusfeuer zu Ostern. Und es kommen Neue hinzu. „Das Maibaumstehlen zum Beispiel“, sagt Franz Rechner, „daran erinnern sich die Ältern bei uns nicht. Da musste der Baum vor dem Aufstellen nicht bewacht werden. Heute jedoch schon.“
Der Austausch zwischen den „Kulturen“ scheint in Thierhaupten also zu funktionieren. Die „Integration“ des bayerischen Marktes ins Schwäbische ist gelungen – auch wenn manche Bürger im Herzen noch bayerisch sind.

Das Ziel ist die perfekt Kruste

Wenn jedes tausendstel Gramm zählt
Seit vielen Generationen ist das Schnupfen eine liebevoll gepflegte Tradition – besonders in Bayern. Auch in unserer Region treffen sich regelmäßig Schnupferfreunde, um die ein oder andere Prise zu genießen.

Die erste "Zweilandstadt"
In Ulm und Neu-Ulm geht man nicht mehr einkaufen, sondern zweikaufen. In den Restaurants wird nicht eingekehrt, sondern zweigekehrt.

Urban. Überraschend. Untergrund
In Dominik Widmanns Bildern treffen abstrakte Formen auf leuchtende Farben, Streetart auf Space-Ästhetik und futuristische Elemente auch schon mal auf ein Känguru.
