
Wie geht es nach dem zweiten Lockdown weiter?

Gut eine Woche vor Weihnachten wird das Leben in Deutschland deutlich heruntergefahren. Für die Zeit danach fehlt eine Strategie. Was Experten dazu sagen.
Teststation und Testlabor sind noch nicht einsatzbereit, da bildet sich schon quer über den Tübinger Marktplatz eine lange Warteschlange vor dem Rot-Kreuz-Pavillon. Jung und Alt stehen da, die Menschen halten Abstand, tragen Maske und warten geduldig in der Kälte. Ganz vorne zwei junge Männer, Leon Müller und Tim Ludwig, die eine Kontaktwarnung von ihrer Corona-App bekamen. Kostenlos können sie hier in Tübingen einen Schnelltest machen. Personalien angeben, Abstrich aus der Nasenschleimhaut nehmen lassen, auf das Ergebnis warten – und 15 Minuten später ist der Befund da. Wer positiv getestet wird, dessen Daten gehen sofort ans Gesundheitsamt, die Betroffenen werden vor Ort über die Folgen aufgeklärt und nach Hause geschickt. „Ich finde das richtig gut“, sagt Passantin Irmtraut Hermann, 87 Jahre alt. Und sie ist nicht die einzige.
Im April-Lockdown noch hatte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bundesweit für einen Aufschrei der Empörung gesorgt mit seiner Aussage, der Lockdown rette mit enormen gesellschaftlichen Folgen möglicherweise Menschen, die aufgrund ihres Alters oder von Krankheiten in einem halben Jahr sowieso tot wären. Er erhielt Morddrohungen, entschuldigte sich später, sprach von einem Missverständnis. Statt Wirtschaft und Kultur lahmzulegen, wollte er eigentlich die Älteren speziell schützen, sagte er – und setzte das daraufhin um.
Corona-Krise: Olaf Scholz spricht von einer Naturkatastrophe
Auf Befehle aus der Staatskanzlei zu warten, ist die Sache des grünen Rebellen aus Baden-Württemberg nicht. Anfangs belächelt, gilt er inzwischen bundesweit als Vorbild im Kampf gegen Corona und vor allem bei der dringenden und immer lauter gestellten Frage nach einem langfristigen Konzept gegen die Pandemie schaut man inzwischen in den Südwesten der Republik. Denn kaum ein Experte glaubt, dass mit dem 10. Januar der Spuk der Pandemie vorüber sein wird. Bis dahin soll der harte Lockdown vorerst gelten. Doch zehn Tage vor Weihnachten blickt das Land verzweifelt auf die steigenden Infektionszahlen und muss erkennen: Der Stichtag wird allenfalls eine Zwischenetappe sein.
Auf unter 50 soll der Inzidenzwert gedrückt werden – aktuell liegt er deutschlandweit bei 176. Vizekanzler Olaf Scholz bekennt offen: „Das ist, wie wenn der Vesuv ausbricht. Da kann man nur noch sehen, dass man sich in Sicherheit bringt – und das ist das, was wir tun.“ Was fehlt, ist eine Strategie, die sich über Monate bis in den Frühsommer durchhalten lässt.
Corona lässt die Sorgen der Deutschen wachsen
Dabei verschärfen sich schon jetzt die Sorgen der Deutschen. Im November berichteten bereits 40 Prozent der Befragten von eigenen Einkommenseinbußen, so das Ergebnis einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung. Im Juni hatten das erst 32 Prozent gesagt. „Die Pandemie verstärkt bestehende soziale Schlagseiten“, erklärt die wissenschaftliche Direktorin des WSI-Instituts, Bettina Kohlrausch. In der Folge hat auch die Zustimmung zum Krisen-Management der Bundesregierung abgenommen. Nur noch 55 Prozent zeigten sich zufrieden oder sehr zufrieden mit den Maßnahmen. 90 Prozent machen sich Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der im Frühjahr so erfolgreich herausgearbeitete medizinische und politische Vorsprung ist verloren. Die Angst vor einer Lockdown-Endlosschleife geht um. Was also tun?
Anders als Bund und Länder, baut Tübingen nicht auf die Wucht eines Lockdowns für alle, sondern auf den Schutz von Risikogruppen. Schon seit Mai gibt es ein spezielles Programm für Senioren. Dazu gehören ein Senioren-Einkaufsfenster, günstige Einzelfahrten im Sammeltaxi und kostenlose FFP2-Masken von der Stadt. Seit September gibt es nun kostenlose Schnelltests in Heimen für Personal und Bewohner, seit Oktober für die Besucher und seit drei Wochen ist das Testmobil im Einsatz, fünf Tage die Woche. Rund 1500 Schnelltests haben die Ehrenamtlichen und Helfer schon durchgeführt, finanziert durch das Rote Kreuz und Spenden. Die Stadtkasse überweist vorerst eine halbe Million Euro.

Der Erfolg gibt dem grünen Oberbürgermeister recht: Zumindest in den Pflegeheimen konnte die Pandemie inzwischen weitgehend eingedämmt, wenn auch nicht ausgemerzt werden. Vom „Tübinger Wunder“ war die Rede. Dabei, so Palmer, ist es doch nur nüchterne Krisenpolitik. „Das ist ja keine Erfindung von mir, sondern steht in jedem Pandemieplan: Wenn die Infektionen nicht mehr ausgerottet werden können, muss man zum Schutz der Risikogruppen übergehen“, sagt Palmer. Doch dafür habe der Mut gefehlt. „Die Verwechslung von Differenzierung und Diskriminierung ist eines der Probleme der Politik.“
Boris Palmer kritisiert zögerliche Politik
Hätte ein landes- oder gar bundesweites Schutzkonzept nach dem Tübinger Muster also dazu beitragen können, die aktuelle dramatische Infektionslage und damit den ab Mittwoch geltenden Lockdown zu verhindern? „Nein“, bekennt Palmer. „Dafür reicht unser Konzept nicht – weil es die allgemeine Infektionsausbreitung nicht unterbinden kann.“ Hierfür hätte es weitere Instrumente gebraucht, wie eine bessere App zur Nachverfolgung der Infektionsketten – einen gemeinsamen Kraftakt von ganz oben also. „Aber das Tübinger Modell hätte sicher viele Todesfälle verhindern können.“
Und genau deshalb sieht sich der als streitbar bekannte Palmer in seinem Weg bestätigt. Denn einiges von dem, was Kanzlerin Angela Merkel und die Riege der Ministerpräsidenten in ihrer Hauruckkonferenz am Sonntag beschlossen haben, wirkt tatsächlich wie eine Blaupause der Strategie der Kleinstadt am Neckar. Neben dem Lockdown sind verpflichtende Tests in Alten- und Pflegeheimen eines der zentralen Elemente des Masterplans der Bundesregierung und der Länder. „Damit wird eine ganz große Leerstelle in der Corona-Politik geschlossen“, sagt der Oberbürgermeister.
Weitere klaffen allerdings noch immer – und zwar sperrangelweit. Und diese Leerstellen haben den bevorstehenden Lockdown aus Sicht von Palmer letztlich unvermeidbar gemacht. „Es geht nicht anders“, sagt der OB über das Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Und schiebt hinterher: „Hätten wir das letzte halbe Jahr genutzt, um effektive Schutzstrategien für die älteren Menschen zu etablieren, hätten wir eine Kontaktverfolgung wie in Südkorea oder Taiwan gegen absurde Datenschutzbedenken durchgesetzt, hätten wir diesen Kampf gesucht, stünden wir heute besser da.“
Abschied von Datenschutz-Grundsätzen in der Corona-Krise
Tatsächlich ist es die technische Nachverfolgung von Kontakten und damit der Abbau des Datenschutzes, die inzwischen immer wieder genannt wird, als scharfe Waffe im Kampf gegen das Virus. Die jetzige Corona-Warn-App erfüllt die Erwartungen nicht, zu viele Hindernisse bremsen sie aus. Das Vertrauen in ihre Möglichkeiten ist angeknackst.
Und auch Palmer hält einen Neustart oder zumindest eine Ergänzung für dringend erforderlich; GPS-Daten etwa in die App zu integrieren, um so Laufwege nachzuverfolgen. Technisch ist das kein Problem, moderne Smartphones zeichnen ohnehin eine Vielzahl von Bewegungsprofilen auf. „Dann müssten wir auch nicht mehr mit der Schrotflinte rumschießen, wir brauchen jetzt chirurgische Eingriffe“, appelliert Palmer. Viel hänge nun am Mut der Politik – und da seien die nächsten vier Wochen entscheidend. „Wenn wir am 10. Januar den Lockdown verlängern und das vielleicht sogar bis April durchziehen, dann ist der Schaden an Wirtschaft und Gesellschaft und Gesundheit so immens, dass wir das nicht durchstehen.“
Das glaubt auch Palmers bayerische Parteifreundin Katharina Schulze. „Die Pandemie ist am 10. Januar nicht zu Ende“, sagt die Fraktionschefin der Grünen im Landtag. Einen Fünf-Stufen-Plan mit dem schlichten Titel „Leben mit der Pandemie“ schlägt sie vor, der soll bei Erreichen regionaler Inzidenzschwellen klare Handlungsmaßgaben festlegen. Die Menschen und die Betriebe bräuchten endlich Planungssicherheit, bis es einen Impfschutz gebe.
Christian Lindner: "Der harte Lockdown ist eine Notbremse"
Einer, der den Corona-Kurs der Regierung seit langem kritisiert, ist FDP-Chef Christian Lindner. Durch die Entscheidung der Ministerpräsidentenrunde sieht er sich in seiner Haltung bestätigt, dass es den Entscheidern an einem Plan fehle. „Der harte Lockdown ist eine Notbremse“, sagt Lindner. Sein dringender Rat: „Die Zeit über Weihnachten muss genutzt werden, um endlich eine Langfriststrategie zu entwickeln. Ansonsten werden wir aus der Dauer-Debatte um Verlängerungen und Verschärfungen nicht herausfinden.“

Bis heute sei es nicht gelungen, einen Schutzschirm über die wirklich gefährdeten Menschen zu spannen. Die vergangenen Monate seien trotz wiederholter Forderungen der FDP nicht dafür genutzt worden, etwa Alten- und Pflegeheime mit Schnelltests und FFP2-Masken auszustatten. Was Lindner fordert, dürfte Boris Palmer gefallen: Die Schnelltestkapazitäten müssten ausgebaut werden. Ohne Schnelltest soll es keinen Zugang mehr zu den Einrichtungen geben. Die Bundesregierung sollte kostenlos ausreichend FFP2-Masken zur Verfügung stellen. In Alten- und Pflegeheimen, aber auch in Schulen müsse unverzüglich mit der Installation von Luftfilteranlagen begonnen werden. Für Gastronomie, Sport und Kultureinrichtungen müssten Schutzkonzepte entwickelt werden, die einen Betrieb auch in Zeiten der Pandemie ermöglichen. Es ist eine ganze Litanei aus Maßnahmen, die inzwischen zum Konsens wurden – und an deren Umsetzung es hapert.
Physikerin Priesemann: Corona-Inzidenzwert muss unter 50 sinken
Und doch gibt es durchaus so etwas wie (verhaltene) Rückendeckung für die aktuelle deutsche Corona-Politik. Und die kommt ausgerechnet von Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut, geboren in Bobingen. Priesemann hatte zuletzt immer wieder die Ministerpräsidenten für ihre zögerliche Haltung kritisiert. Das Herumdoktern war ihr ein Dorn im Auge. Durch die Entscheidung für einen harten Lockdown sieht sie sich in ihrer Haltung klar bestätigt. Nicht der Lockdown sei das Problem, sondern die hohen Fallzahlen. „Man kann sich das wie einen Brand vorstellen: Wir versuchen ihn, mit dem Wasserschlauch und ein paar Eimern Wasser oder Sand unter Kontrolle zu bringen. Das kann man anfangs versuchen. Wenn das aber nicht gelingt, dann muss man die Feuerwehr rufen: Je schneller, desto geringer der Schaden und desto kürzer der Lockdown“, sagt sie.

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens ist also auch aus ihrer Sicht alternativlos. Es müsse das unverrückbare Ziel sein, die Wocheninzidenz unter 50 oder gar unter 35 zu drücken. Priesemann ist überzeugt: In den meisten Bundesländern könnte das gelingen. Für alle Länder und alle Landkreise, die nicht klar unter der Grenze von 50 sind, müsse man aus wissenschaftlicher Sicht den Lockdown verlängern oder verschärfen. „Ansonsten verpuffen die Maßnahmen“, sagt die Wissenschaftlerin. „Außerdem gefährden Regionen mit hohen Fallzahlen die Kontrolle und Sicherheit in den Nachbarregionen.“ Dass wir bis zum Frühjahr mit hohen Fallzahlen leben können, glaubt sie nicht. „Bei hohen Fallzahlen ist die Eindämmung viel schwieriger und aufwendiger“, sagt Priesemann. „Hohe Fallzahlen haben keinerlei Vorteile für Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft.“
Deshalb fordert sie, den eingeschlagenen Weg mit aller Konsequenz zu gehen. Firmen müssten mehr Homeoffice ermöglichen, Kantinen schließen, Arbeitstreffen in die virtuelle Welt verlegt werden. „Es geht jetzt darum, die nächsten drei Wochen zu nutzen, um die Fallzahlen deutlich unter 50 zu senken – damit wir nicht ewig unter einem Lockdown light leiden, sondern wieder mehr Freiheiten bekommen“, sagt Viola Priesemann.
Lesen Sie hierzu auch:
Nächtliche Ausgangssperre in Bayern gilt auch über Weihnachten
Ein Jahr Corona: Alles wieder normal im damaligen Epizentrum Wuhan?
Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

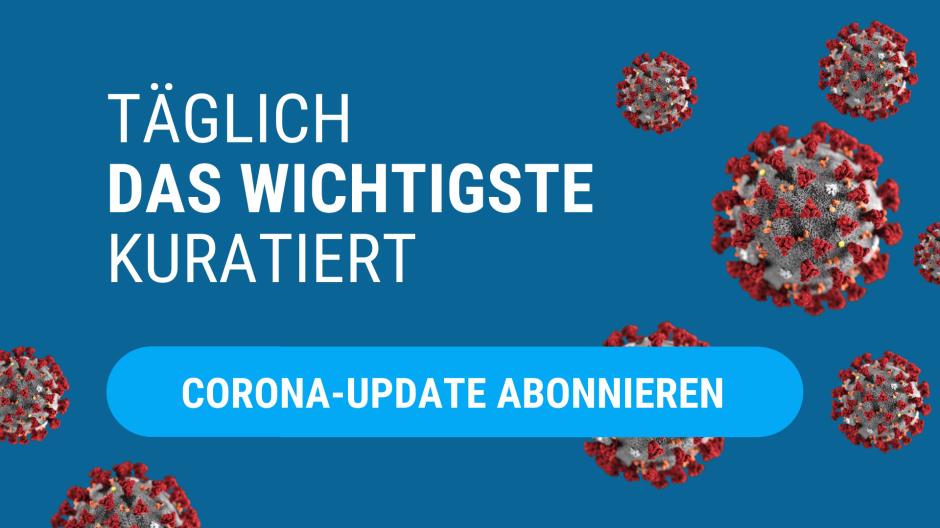
Die Diskussion ist geschlossen.
Ganz einfach: die vitalen Menschen sind am Ende ihrer Kräfte/Nerven und fallen dann auch noch aus. Deutschland habe mit dieser Politik fertig.