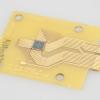Es klingt wie Zukunftsmusik: Winzigste halbleitende Nanodrähte ermöglichen als Biosensoren detaillierte Einblicke in einzelne Zellen oder spüren Krankheiten wie Krebs im Frühstadium auf. Tatsächlich werden solche hochleistungsfähige Sensoren bereits in spezialisierten Laboren eingesetzt, doch für den Alltagsgebrauch – zum Beispiel in Arztpraxen – ist ihre Herstellung schlichtweg zu aufwendig und zu teuer. Im Zuge seines durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts Sense-U hat der Ulmer Juniorprofessor Steffen Strehle eine „Bürstentechnik“ entwickelt, die die Massenproduktion präziser Nanosensoren ermöglicht. Inzwischen ist die zweite Förderphase des Erfolgsprojekts angelaufen.
Ulm