
Die Folgen der Pandemie treffen die christlichen Glaubensgemeinschaften hart. Sie müssen sparen und sich neu erfinden – etwa beim direkten Kontakt mit Gläubigen.
Die Zeit des Gottesdienstverbots geht ihrem Ende entgegen. Doch Fotos leerer Gotteshäuser werden zu jenen Bildern der Corona-Krise gehören, die im kollektiven Gedächtnis bleiben werden. Nicht, weil leere Gotteshäuser so außergewöhnlich sind. Sondern weil in den Fotos die Erkenntnis mitschwingt: Für Gläubige ist der Glaube – und die Gemeinschaft im Glauben – nicht nur systemrelevant, sondern existenziell.
In der Corona-Krise zeigt sich gerade, was für die Kirchen noch wesentlich wichtiger werden wird: die Seelsorge-Praxis und die Frage ihrer Finanzierung.
Die Kirche hat die Möglichkeiten der Digitalisierung vernachlässigt
Die Seelsorge ist der Kern dessen, was Kirche ausmacht. Der Bedarf nach Seelsorge ist groß in dieser Krise. Geistliche decken ihn mit hohem Einsatz und Kreativität. Sie rufen Gläubige an oder organisieren Hilfe für Ältere. In Memmingen spielten ein katholischer und ein evangelischer Priester gemeinsam vor Altenheimen Trompete. In Augsburg beantwortete der ernannte Bischof Bertram Meier Fragen von Zuschauern live im Internet. Deutschlandweit sehen sich Zehntausende Online-Gottesdienste an – und das, obwohl die Zahl der Gottesdienstteilnehmer in der katholischen Kirche zuletzt bei durchschnittlich 9,3 Prozent lag.
Die mitunter hektisch aus dem Boden gestampften Streams und Youtube-Videos können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kirchen die Möglichkeiten der Digitalisierung vernachlässigt haben. Viele hielten lieber am Pfarrbrief fest. Dabei ist es ihr ureigenster Auftrag, das Evangelium zu verkünden, auf allen Kanälen. Das sollte nun selbst der medien-scheueste Geistliche verstanden haben.
Eine Lehre aus der Corona-Krise muss also lauten, stärker und individueller den Weg zu jedem – auch Nicht-Gläubigen – zu suchen. Und dabei digitale Kanäle systematischer und professioneller zu nutzen.
Jetzt zum Finanziellen: Die Kirchensteuer ist die Haupteinnahmequelle der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland. Sie leben recht gut von ihr, insbesondere weil die Erträge trotz sinkender Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren dank wachsender Wirtschaft und einer hervorragenden Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gestiegen sind. Dass die finanzielle Sicherheit, die von der Kirchensteuer ausgeht, trügerisch ist, wissen Kirchenverantwortliche. Sie kennen die Prognose von Forschern, dass die katholische und evangelische Kirche in Deutschland bis 2060 fast die Hälfte ihrer aktuell knapp 45 Millionen Mitglieder verlieren könnten.
Die Corona-Krise hat auch für die Kirche dramatische finanzielle Folgen
Das allein hätte massive Auswirkungen auf die Kirchenfinanzen. Die Corona-Krise und die mit ihr einhergehende Wirtschaftskrise verschärft die Situation dramatisch. Auf die Kirchen rollt eine schwierige und für sie gefährliche Debatte zu: Was leisten wir uns? Was müssen wir einsparen? Wo es an Geld mangelt und Rücklagen nicht reichen, werden kirchliche Angebote gestrichen. Im Erzbistum Hamburg war das bereits vor der Pandemie so; dort werden kirchliche Schulen geschlossen. Was zeigt: Die Kirchen mögen auf dem Papier milliardenschwer sein. Über ihre liquiden Mittel und jeweiligen Vermögensverhältnisse sagt das wenig.
Umso unverständlicher waren daher Reaktionen auf den Vorstoß des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke vor einem Jahr. Er forderte, die katholische Kirche müsse auf Privilegien verzichten und „über andere Möglichkeiten der Finanzierung“ nachdenken. Als Vorbild nannte er die Niederlande, wo sich die Kirche über Spenden finanziert. Dafür wurde Hanke belächelt, ja kritisiert. Aber für Denkverbote darf in der Krise in der Kirche kein Platz mehr sein – weder bei den Finanzen noch der Ansprache der Gläubigen.
Über alle wichtigen Entwicklungen bezüglich des Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.
- Kirchensteuer bricht weg: Wie Corona die Kirche vor Finanzprobleme stellt
- Bayern verlängert Corona-Beschränkungen bis 10. Mai
- Finden im Mai trotz Corona wieder Gottesdienste statt?
Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.


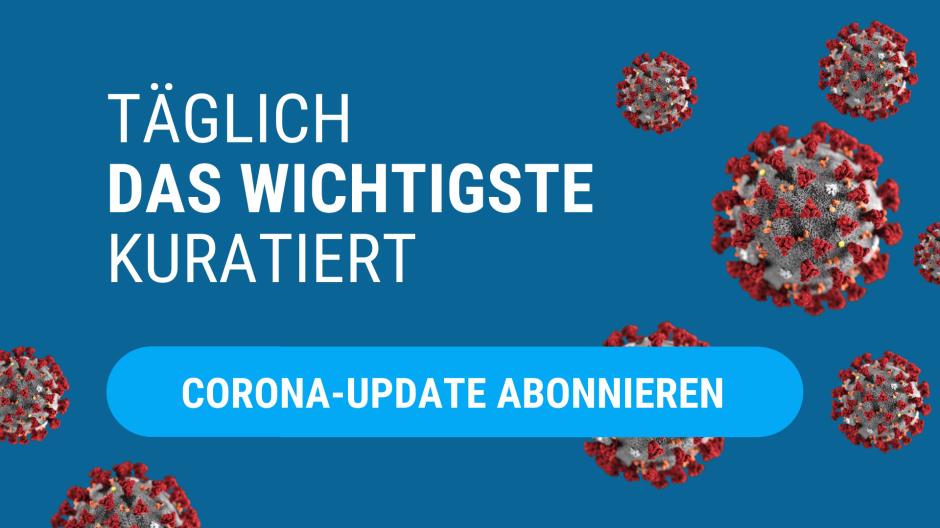
Die Diskussion ist geschlossen.
Ich sage gleich am Anfang, dass ich aus tiefster Überzeugung bekennender Atheist bin und die Bettelbriefe der 2 großen Hauptkirchen mich peripher tangieren und mein Mitleid gegen 0 tendiert.
Solange sie noch das Privileg haben, dass der deutsche Staat Zwangseintreiber für diese Kirchen spielt, kann es ihnen nicht schlecht genug gehen. Und wenn die liquiden Mittel nicht mehr ausreichen, können sie ein paar Vermögenswerte wie Grundstücke veräußern.
Sehr konservative Schätzungen gehen davon aus, dass alleine die katholische Kirche in Deutschland ein Vermögen von mindestens 200 Milliarden Euro hat. Das wird wohl um einiges mehr sein. Und dann bin ich gezwungen, mir als Atheist das unberechtigte Gejammere anhören zu müssen?
Aber eine Sache macht mich besonders wütend:
Warum bin ich als Atheist gezwungen, mit meinen Steuergeldern das Gehalt der Priester der Priester und Bischöfe zu bezahlen?
Die rund 12 Milliarden Euro Kirchensteuer, die beide Hauptkirchen erhalten, sollten eigentlich dafür reichen.
Ich bin dafür, dass der Staat die Gehälter der Kirchenangestellten nicht mehr bezahlt, sondern die Kirchen dies selbst tun sollten.
Ich finde es echt lustig:
Als Atheist bleiben mir kirchliche Trauungen verwehrt, aber ich soll für das Gehalt der kirchlichen Angestellten mitbezahlen.
Was für eine ekelhafte Doppelmoral.
In diesem Sinne
Hallo Athanassios,
das liegt daran, dass die Politik seit über hundert Jahren dem verfassungsrechtlichen Auftrag (schon in der Weimarer Verfassung festgelegt, ins GG übernommen) die Enteignung der Kirchen durch die Säkularisation ein für allemal auszugleichen, nicht nachgekommen ist. Die Kirchen sträuben sich nicht einmal dagegen. Der Staat will nicht, weil's zunächst halt mehr Geld kosten würde als so.
Lesen Sie diesen Artikel, der ist sehr aufschlussreich: https://www.katholisch.de/artikel/20619-warum-der-staat-den-kirchen-immer-noch-geld-zahlt