
"Die Revolution hatte einschneidende Folgen"

"Wir feiern Bayern", so lautet das Motto zum 100. Geburtstag des Freistaats Bayern: Was wir warum feiern, erklärt Dr. Richard Loibl, Leiter des Hauses der Bayerischen Geschichte.
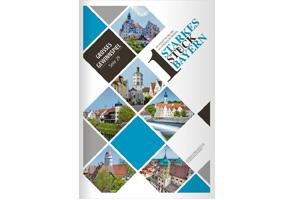
Am 7. November 1918 proklamierte in München der Schriftsteller und Journalist Kurt Eisner den Freistaat Bayern und stürzte den König. Einen Tag später übernahm auch in Augsburg ein Arbeiter- und Soldatenrat die Macht. Wie muss man sich die Vorgänge in der Stadt Augsburg vorstellen?
Dr. Richard Loibl: Die Revolution ging in Augsburg wie in ganz Bayern relativ friedlich vonstatten. Das ist auf der einen Seite erstaunlich, weil sie keineswegs von langer Hand vorbereitet war, sondern eher improvisiert wurde. Auf der anderen Seite erklärt sich das aus dem allgemeinen Erschöpfungszustand, in dem sich das Land nach vier Jahren Weltkrieg befand. Die Menschen waren extrem ausgezehrt, deshalb konnte auch eine Grippeepidemie Tausende dahinraffen. Die Monarchie leistete keinen Widerstand. Getragen wurde die Revolution vor allem von den Unabhängigen (USPD). Sie hatten sich von der SPD abgespalten, weil sie das alte Regime und damit auch den Krieg mitgetragen hatte. Die Unabhängigen in Augsburg und München waren natürlich eng vernetzt, deshalb wurde die in München am 7.11. aus einer Friedensdemonstration heraus durchgeführte Revolution ohne Verzögerung in Augsburg fortgesetzt. Am 8. November morgens streikte die Arbeiterschaft der MAN. Die Soldaten schlossen sich an. Augsburg war damals, wie im Bismarckviertel heute noch zu sehen, wichtige Kasernenstadt. Ein Arbeiter- und Soldatenrat mit Ernst Niekisch als Vorsitzendem übernahm die Regierung. Die Revolutionäre besetzten die strategisch wichtigen Gebäude. Deshalb wehte am Augsburger Rathaus nur wenige Stunden nach München die rote Fahne.

Die Arbeiterstadt Augsburg bildete zusammen mit der Hauptstadt München ein Zentrum des Umsturzes. Wie war die Lage in ländlichen Gebieten in Bayerisch-Schwaben und in kleineren Städten wie Günzburg oder Donauwörth?
Dr. Loibl: Es gilt die Regel, dass überall dort, wo es Industrie und/oder Militär gab, die Revolution relativ schnell Fuß fasste. In Donauwörth und Günzburg traten schon wenige Tage nach Beginn der Revolution Arbeiterräte in Erscheinung. Ähnlich wie in Augsburg waren sie darauf bedacht, Ruhe und Ordnung und vor allem die Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten. Solche Räte entstanden auch in Burgau oder Ichenhausen und sogar in manchen Dörfern als Bauernräte – übrigens eine bayerische Besonderheit. Auf der anderen Seite gab es aber gerade auf dem Land Kommunen, die von der Revolution mehr oder weniger nur aus der Zeitung erfuhren. Vielfach blieben die Beamten als Vertreter der alten Ordnung einfach im Amt und die Königsporträts in den Amtsstuben hängen.
Sie haben Ernst Niekisch erwähnt, Grundschullehrer an der Wittelsbacher Schule und dann der Mann an der Spitze des Arbeiter- und Soldatenrats. Der sollte später noch ein sehr bewegtes Leben führen…
Dr. Loibl: Niekisch hat alle Höhen und vor allem Tiefen der sozialistischen Bewegung in Deutschland mitgemacht, bis zur SED-Diktatur in der DDR. In Bayern zählte er zum Führungspersonal der Revolution, zuerst als SPDler und am Ende bei den Unabhängigen. Dabei stieg er sogar als Nachfolger Eisners zum Vorsitzenden des Zentralrates in München auf. Seine Basis hatte er aber in Augsburg. Diese votierte Anfang April 1919 für die Ausrufung der Räterepublik und schickte den unwilligen Niekisch mit einem entsprechenden Antrag nach München - der gegen seinen Willen angenommen wurde. Man sieht dabei die große Bedeutung Augsburgs für die Revolution, die politisch - auch das zeigt dieser Vorgang exemplarisch - nicht immer einer klaren Linie folgte. Für Niekisch ging die Sache nicht gut aus, er verlor sein Amt an Ernst Toller. Anfang Mai 1919, nachdem die Räterepublik von den Kommunisten übernommen worden war, wurde die Revolution von Reichstruppen, die die Bamberger Exilregierung zu Hilfe gerufen hatte, und Freikorpsverbänden blutig niedergeschlagen.
Nach der Niederschlagung der Räterepublik, wurde Niekisch gefangen genommen und saß als Hochverräter zusammen mit den Schriftsteller-Revolutionsführern Erich Mühsam und Ernst Toller in Niederschönenfeld in Festungshaft. Warum waren so viele Künstler an den Vorgängen beteiligt?
Dr. Loibl: München war um 1900 ein Eldorado der Künstler und Literaten. Das hängt mit dem Mythos Bayern zusammen, dem wir in unserer Landesausstellung in Ettal ab Mai 2018 nachspüren. Bayern war damals eine Sehnsuchtslandschaft und galt als besonders liberal und sozial, München im Besonderen und noch dazu als herausragende Kunststadt. Wie viele Mythen hat auch dieser einen wahren Kern. Untersuchungen haben nachgewiesen, dass im Vergleich zum von Militär und Großkonzernen beherrschten Preußen Bayern mit seiner eher klein- bis mittelständischen Struktur deutlich freiheitlicher aufgestellt war. Gerade die Linken konnten von dem gemäßigten liberalen Klima profitieren. Entsprechend groß war die Anziehungskraft. Wenn man irgendwo eine ideale Gesellschaft verwirklichen könnte, dann in Bayern, war eine verbreitete Ansicht der Reformer.
Inwieweit wurde mit der Revolution 1918 eine neue Epoche eingeläutet? Stichwort Frauenwahlrecht und Sozialstaat.
Dr. Loibl: Dafür, dass die Revolution erst im November 1918 begonnen hatte und Anfang Mai 1919 bereits niedergeschlagen war, hatte sie einschneidende Folgen. Der Systemwechsel von Monarchie auf Republik wurde nicht wieder rückgängig gemacht. Epochal war die Einführung des Frauenwahlrechtes, auch dieses blieb, genauso wie Arbeitszeitbegrenzungen in Richtung auf die 40-Stunden-Woche. Was blieb, waren aber auch viele Tausend enttäuschte und radikalisierte Revolutionäre wie Konterrevolutionäre. Sie bildeten mit das Potential für den Aufstieg Hitlers, der in München begann.
In den folgenden Jahren kam es zu einem Aufschwung in Kunst, Kultur, Sport und auch Wirtschaft. Inwiefern machte sich das auch in unserer Region bemerkbar?
Dr. Loibl: Der Aufschwung betrifft eigentlich nur die Jahre 1924 bis 1928, davor war Bayern noch sehr instabil. Man denke nur an den Hitler-Putsch und die Hyperinflation von 1923. Ein besonderes Augsburger Problem war, dass sich der Maschinenbau, im Ersten Weltkrieg die dominierende Branche, nur langsam von der Inflation erholte. Auch die Textilindustrie, die vier Jahre ohne Baumwolle hatte auskommen müssen, ohne dass Hanf oder Brennnessel zu ernsthaften Alternativen entwickelt werden konnten, war schwer angezählt. Heute kann man das übrigens noch am Glasplast (das frühere Werk IV der Spinnerei und Weberei Augsburg) erkennen, der vor dem Ersten Weltkrieg verdoppelt werden sollte. Das kam danach gar nicht mehr in Frage. Deshalb blieb die der Schleifenstraße zugewandte Schmalseite, wo der Anbau angedockt hätte, fensterlos. Die größte Herausforderung für die Stadt Augsburg ergab sich aber aus dem kriegs- und inflationsbedingten Rückstau im Wohnungsbau. Dabei war klar, dass sich die Bevölkerung Augsburgs in absehbarer Zukunft von ca. 200.000 auf 400.000 verdoppeln würde. Zwei absolut wegweisende städtebauliche Planungen von Thomas Wechs senior und Theodor Fischer trugen dem Rechnung. Neue Stadtteile wie die Hammerschmiede, Hochzoll oder der Bärenkeller gewannen hier erstmals Konturen. Spitzenmäßige Wohnungsbaukomplexe entstanden unter Regie der gerade gegründeten WBG: der Zeppelinhof in Hochfeld sowie Lessing- und Schuberthof in der Rosenaustraße, letztere Musterbeispiele des Neuen Bauens mit europäischer Bedeutung. Wer sich für Kirchenbau aus der Zeit interessiert, sei noch auf die St. Antonskirche am Wittelsbacher Park von Michael Kurz verwiesen, sehr sehenswert! Hier liegen die großen und bleibenden kulturellen Leistungen der Stadt in den 1920er Jahren.
Es ist ja schon ein wenig kurios: Mit dem Jubiläum „100 Jahre Freistaat Bayern“ feiern wir auch die Abschaffung der Monarchie. Liegt aber nicht ganz viel vom Selbstverständnis der Bayern in den 112 Jahren Königreich begründet? Etwa im Sinne der bekannten Fernsehserie „Königlich-Bayerisches Amtsgericht“: „Es war eine liebe Zeit, die gute, alte Zeit vor 14. In Bayern gleich gar…“
Dr. Loibl: Wir feiern 100 Jahre Freistaat und damit die erfolgreiche Etablierung unserer modernen demokratischen Gesellschaft. Zugleich feiern wir 200 Jahre bayerische Verfassungskultur. Wir hatten lange vor Preußen oder Österreich eine vergleichsweise liberale Verfassung. Das war ein Verdienst der Wittelsbacher Könige. Über beide Jubiläen dürfen wir uns freuen, vor allem wenn man die kapitalen Rückschläge bedenkt und den Traditionsbruch durch das Terrorregime der Nationalsozialisten nicht vergisst.
Sie beschäftigen sich professionell tagtäglich mit der bayerischen Geschichte. Was macht eigentlich für Sie persönlich den Mythos „Bayern“ aus?
Dr. Loibl: Wenn ich mit dem Radl vorbei am Alpenpanorama (man sieht es wirklich manchmal!) unterhalb des Wittelsbacher Schlosses von Friedberg Richtung Augsburg eindrehe, Ulrich-, Perlach- und Rathaustürme sehe, das ist mein ganz persönlicher alltäglicher Mythos Bayern.

Das Ziel ist die perfekt Kruste

Wenn jedes tausendstel Gramm zählt
Seit vielen Generationen ist das Schnupfen eine liebevoll gepflegte Tradition – besonders in Bayern. Auch in unserer Region treffen sich regelmäßig Schnupferfreunde, um die ein oder andere Prise zu genießen.

Die erste "Zweilandstadt"
In Ulm und Neu-Ulm geht man nicht mehr einkaufen, sondern zweikaufen. In den Restaurants wird nicht eingekehrt, sondern zweigekehrt.

Urban. Überraschend. Untergrund
In Dominik Widmanns Bildern treffen abstrakte Formen auf leuchtende Farben, Streetart auf Space-Ästhetik und futuristische Elemente auch schon mal auf ein Känguru.
